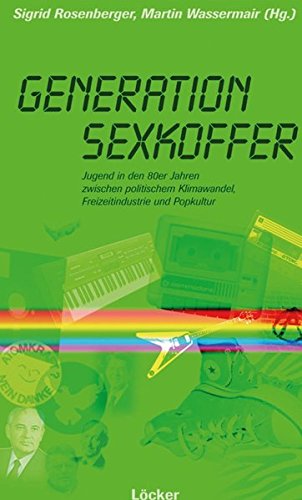 (Beitrag „Generation Sexkoffer“ – 2007, Löcker Verlag)
(Beitrag „Generation Sexkoffer“ – 2007, Löcker Verlag)
No Future“. Wer dabei an den Punk-Slogan denkt, liegt falsch. Oder auch nicht. „No Future“ stand in riesigen Lettern auf dem Poster an der Wand. Kein Wunder, dass sich meine Eltern Sorgen machten. Wahrscheinlich wäre es OK gewesen, wenn es ein Punk-PinUp gewesen wäre. Mit einem greinenden Johnny Rotten, oder – besser – den gitarreschwingenden Clash. Die ich alle erst später zu hören angefangen habe.
Mit jungen Leuten mit wilden Frisuren, in dreckigen Klamotten. Die „dir den Finger zeigen“. Irgendeiner der unvermeidlichen Musikfanposter, den pubertierende, protestierende Jugendliche an Wände pappen.
Damit hätte ich bestenfalls meinen rechtsnationalen Grossvater provozieren können. Für den sowieso alles mit Schlagzeug „Negermusik – Getrommle“ war. Nur: provozieren wollte ich nicht. Eher Pessimismus plakatieren. Bewältigen. Irgendwie so.
Im Hintergrund des Slogans war auf dem Poster eine nukleare Explosion. Eines dieser überbelichteten Atompilzfotos in Schwarzweiss, die jeder kennt. Bedrohlich. Ausweglos. Sowieso alles egal, denn die Welt wird dir in die Luft geblasen. Warum viel planen? Sich irgendeine schöne, verlogene Zukunft als Erwachsener ausmalen? Als Rad im bourgeoisen Sinnbetrieb auf Talfahrt? Wozu das alles?
Als ich als Vierzehnjähriger 1980 den Poster montierte, war ein Ende des Kalten Kriegs nicht in Sicht. Und mein Einstieg in die Dekade dementsprechend schlecht. Auf der einen Seite die heile, geordnete Welt meiner bürgerlichen Familie mit – vergleichsweise – toleranten Eltern. Auf der anderen Seite der Planet am Abgrund. Alles im Arsch.
Heute hätte ich im gleichen Alter vermutlich irgendeine Klimakatastrophen-Endzeit über dem Bett. Kein Zufall, dass gerade jetzt der Kalte Krieg, damit verbundene gesellschaftliche Phobien, Angst vor dem „unvermeidlichen“ Resultat, Devianz als mentale Abwehr davor, ein mediales Revival erlebt. Erleben muss. So wie heute das globale Klimadesaster immer unvermeidlicher scheint, erschien mir das atomare Desaster unvermeidlich. Alles im Arsch. Und wenn sich Punk als nihilistischer Eskapismus aus dem Armagedon des Kalten Kriegs verstehen lässt, kann man auf Reaktion der Jugendkulturen auf unsere aktuellen Bedrohungen schon mehr als gespannt sein.
Von Punkhaltungen hatte ich damals keine Ahnung. Dafür antizipierte ich unbewusst dessen Nihilismus. Für Rebellionen war es noch zu früh. Zu Drogen hatte ich keinen Zugang. Was blieb noch? Eskapismus. Ausstieg. Dafür gab es ideale Rahmenbedingungen.
„Escape“ braucht eine Gegenwelt, die fremden, möglichst realitätsfernen Regeln folgt. Und in die Du – vielleicht – eher eigene Regeln einbringen kannst. Dachte ich. Und verliess deshalb die katholische Internatsschule nicht, wie ich es ursprünglich nach vier Jahren vorgehabt hatte. Besser die jugendliche Verzweiflung im geschützten Rahmen ungestört ausleben. Als mit besorgten, lästigen Eltern teilen. Dachte ich. Ghetto, statt eine sich auflösende Welt ohne Chance. Ohne Gnade.
Damit Gegenwelt funktioniert und aufrecht bleibt, braucht es: Informationsbeschränkung. Die 1980er-Jahre waren für mich ein selbstgewähltes, informationstechnisches Neandertal, und ich einer seiner Bewohner.
Wer heute eine urbane Clique von Jugendlichen beobachtet, versteht zeitgenössische Informationsbeschaffung und -verteilung. Auswahl, Zugang zu Quellen und Vertrieb selbstverständlich. Mit Rasanz genützt und beschickt: Daumen mit den Handytasten verschweisst. Eine SMS jagt die andere. Klingelton heruntergeladen, ausprobiert, weggeworfen oder an Friends weitergeschickt. Die Fehlleistungen der Lehrer mitgeschnitten, fotografiert und aufs eigene Weblog gestellt. In Schulen stöhnen PädagogInnen und überlegen Handyverbote. Internet, Mobiltelefonie, Kabelfernsehen, Radiovielfalt. Ausgehen, Chatrooms, Filesharing.
In meinem Ghetto hingegen war der Zugang zum „M&M eines männlichen Jugendlichen“ – Musik & Mädchen – erschwert. Dafür „R&B – Rhythmische Messen & Büffeln von Lateinvokabeln“ reichlich im Angebot.
Verboten: Ausgang. Mädchen – klar. Selbst „Bravo“ nicht erlaubt. Doktor Sommer´s Beratungskolumne wegen, die sich mit vorehelichem Bekanntwerden und anschliessender Annäherung beschäftigt. Und unfallfreiem Vollzug. Alles, wofür der Papst wenig Toleranz zeigte.
Knapp: Bücher. Nur die richtigen. Die falschen konfisziert.
Reglementiert: Zeiteinteilung. Fernsehen – zugelassen, was die TV-Kritik der Kirchenzeitung als artgerecht empfahl. Unter Aufsicht. Natürlich. Als erwähnter Papst angeschossen wurde, war es auch damit vorbei. TV wegen Schultrauer gestrichen. Ich betete inbrünstig für sein Leben. Und wagte mir nicht auszumalen, was noch alles gecancelt wird, wenn er es nicht schafft. Ich hasste ihn.
Das Mobiltelefon noch nicht erfunden. Telefonieren – nona – unter Aufsicht, Ausnahme Angehörige. Einziger Apparat beim Erzieher.
Es gab es auch den – in autoritären Strukturen unvermeidlichen – „Underground“. Rauchen, Alkohol, Bubenbanden, Kleinkriminalität. Hier galten zumindest teilweise meine Regeln. Wenn man sich durchsetzte. Was oft nicht der Fall war. Wer jemals Klosterschul-Literatur gelesen haben, kennt das alles. Und gab es auch alles. Und soll hier nicht ausgebreitet werden.
Ohne gröbere Schäden liess sich die Schule nur durch virtuelle Fenster nach draussen überstehen. Das musste ich bald einsehen. Dafür hiess es warten.
Ab sechzehn gab es Freiräume. Statt Grossraumhaltung im Schlaf- und Studiersaal Aufstieg in die Jugendherberge. Vierbett. Weniger Kontrolle. Und: ein eigenes Radio.
Meines war in Wirklichkeit ein Radiorekorder – schliesslich wollte ich auch eigene Audiokassetten spielen – und hörte laut schnörkeligem Herstellerschriftzug auf „Gracia“. Bestellt von meiner Mutter aus dem weitläufigen Fundus des „Kurfürstversand“, eine Art Vorläufer von „Tschibo“, mit ähnlichem Kram – vom Pürier- bis zum Massagestab.
Barock, schwarz, kantig, weit ausladenderer Lautsprechergrill, viel Chrom und viel Schrift auf allen Tasten – eine offensichtliche Niederlage deutscher Wertarbeit, wirkte das „Ding“ wie die designerische Reduktion „Optik amerikanischer Strassenkreuzer“ auf „Format europäischer Kleinwagen“. Die optisch stimmigere Stereoversion war meiner Mutter zu teuer gewesen. Ich war stolz. Ein Statussymbol.
Vier Jungs, vier Radios, ein Raum, keine Praxis. Wir brauchten Monate, bis wir uns auf erträgliche Modi der Beschallung einigen konnten. Die Wahl des Radiosenders war noch einfach: Ö3. Ö3! Was sonst wenn nicht Ö3? Ö1 und Radio Niederösterreich waren uns schon vorher durch Live – Messübertragungen und Religionfeatures negativ aufgefallen. Die wir uns als „Audiospende“ in Morgenandacht oder Religionsunterricht anhören mussten. Imageschäden, aus Sicht von Seminaristen unrettbar. Radio Burgenland? Ein zwar auffallend profaner Bauernsender, aber eben: Bauernsender. Das wars. Also Ö3.
Ö3 war in den 1980ern auf seinem weiten Weg vom „rotzigen Jugendradio“ – das ich selbst auch nur als Legende der Mediengeschichte kenne – zum „Kommerz-Flachstrand“ heute irgendwo in der Mitte angekommen. Zwar hatten einige unsägliche ModeratorInnen, die uns bis heute bei Privaten verfolgen – wie zum Beispiel Dominik Heinzl – bereits Einzug gehalten und „Quasselton der Belanglosigkeit“ eingeführt. Den ich schon als Sechzehnjähriger abgrundtief hasste. Ansonsten war Ö3 eine Fullservice Informations-Agentur der Populärkultur, die für jeden von uns etwas bot. Bieten musste. Mangels Alternativen bestrich Ö3 nahezu vollständig das Hörersegment „10 bis Noch nicht Tot“, das Interesse an „Was ist wichtig DORT auf der Welt und HIER in Österreich“ und Aversion gegen „Blasmusik-Folklore“ (Landesprogramme), „Streicher-Geheule“ und „Oberlehrer“ (Ö1) teilte.
Vortrag im lockeren, jovialen Stil. Der auch unserer Ausdrucksweise entsprach, wenn auch urbaner, abgeklärter. Die beste, vorallem neueste Musik – bei einem Radio Essenz. Aufgelegt von der Moderation selbst – der „Selektor“ mit beschränkter, automatischer Titelwahl wie heute üblich war noch nicht erfunden. Oldies, Jazz in Sonderformaten, meist Nachts und wissend kommentiert. Wenn es uns auch weniger interessierte. Konzert- und Veranstaltungshinweise. Auch wenn wir sowieso nicht hingehen konnten. Das „Mittags- „und „Abendjournal“ von Ö1 durchgeschaltet. Wir erfüllten unseren politischen Bildungsauftrag und fühlten uns informiert. „Casey Kasem´s American Top 40“ sogar über mehrere Stunden in Muttersprache. Unser „American English“ wurde ausgeprägter.
Wie dominant Ö3 in der Meinungsbildung Jugendlicher einmal war, lässt sich heute nur mehr schwer erahnen. „Es war im Radio…“ hiess Ö3.
„Aufstehen“, brüllte es, und wir brüllten mit „Ö3 Wecker“ zurück. Und summten uns mit „Musik zum Träumen“ in die Nacht. Nach „Lichtaus“. Was verboten war. Natürlich. Wir waren Fans. Und ich hatte mein erstes Fenster.
Weil wir Fans waren, hatten wir unsere Lieblingsprogramme. Vier Jungs, vier Radios, ein Raum. Wir brauchten Regeln. Wichtigste Regel: ist die Sendung fad, wird ein Tape aufgelegt. Was fad ist, bestimmt die Mehrheit. Kopfhörer hatten wir keine. Die sind für Weicheier und Amateurfunker. Gut, wenn dein Liebling mehrheitsfähig ist. Meine Lieblinge: „Musicbox“ und „Zick Zack“. Mit „Zick Zack“ hatte ich wenig Probleme. Da ging es auch um „jugendlichen Sex“ jenseits von Zellteilung. Manchmal. Top. Trotz viel Gelabere. Gelabere = fad.
In der „Musicbox“ wurde viel gelabert. Und ich weiss bis heute nicht, warum wir sie uns trotzdem anhörten. Anhören konnten, weil die anderen fanden das Programm fad und anstrengend. Aber ich bestand darauf. Vielleicht gerade deshalb, weil die anderen nicht wollten. Ich kam gerade in eine Rebellionsphase, eckte in der Schule an, hatte schlechte Noten, suchte Streit. Was mir zwar honorige Posten wie Klassen- und Schulsprecher-Stellvertreter, aber auch den Beinahe-Hinauswurf aus dem Internat einbrachte. „Pfahl im Fleisch der Anstalt, untergräbt die Autorität“, hiess es. Da kam mir DAS gerade recht. Ich machte Krach. Immer wieder. Den anderen wurde das wohl zu mühsam. Ich zu mühsam. Die „Musicbox“ blieb an.
So wie Ö3 ein Pop-Panoptikum des gesamten Radio-ORF´s war, und ihn in ein Programm Stil „FM4“ plus „Ö3-wie wir es heute kennen“ plus „ein wenig BBC1“ komprimierte, hochkomprimierte die Box „FM4“ doppelplus „Der Sumpf“ plus ein wenig „Freie Radio-Anarchie“ in eine Sendestunde öffentlich rechtliches Radio. Täglich. Ab 15h. Heutzutage unfassbar, dass das ging. Die Dichte.
Die „Musicbox“ wird gerne verklärt, war sie doch die unausgesprochene Leitsendung von Ö3. Und alle wollten bei ihr arbeiten. Aber sie war zuerst einmal: besserwisserisch, arrogant, selbstgefällig, elitär. Gerade richtig für mich in meiner Rebellion. War ich alles auch.
Beispielsweise wird erzählt, dass Werner Geier, oder war es Thomas Mießgang? – egal, einer der Box-Heads – AspirantInnen mit der Frage abservierte: „Wieviel Platten hast Du?“ – „Hmhmhm“ – „Komm wieder, wenn Du dreitausend hast. Und DIE und DIE muss dabei sein…“.
Die „Box“ teilte die Pop-Welt ein: in „Gut“ und „Böse“. Böse war alles, was kommerziell erfolgreich war, und – Rechts/Linkswatsche – im übrigen Ö3-Programm lief. Gut ist „Independent“, neue, schräge Musik mit wenig Publikum. Und wenig Erfolg. Für die die Welt noch nicht bereit ist. Da kannte ich mich aus – Gut, Böse, endlich eine andere Religion. So fühlte ich mich selber – „independent“, unentdeckt. Aber auf der richtigen Seite.
Meine Helden: Walter Gröbchen. Fritz Ostermayer. Angelika Lang. Als ich Lang Jahre später das erstemal persönlich begegnete, bekam ich keinen geraden Satz heraus. So gross war mein Respekt.
Die „Box“ war typischer 1980er Musikjournalimus. Sie wollte ein Weltbild vermitteln. Sie wollte ihre HörerInnen auf den richtigen Pfad bringen. Bildungsradio in Rocksender-Camouflage. Ich hatte bei der „Musicbox“ eine Stunde täglich Nachhilfeunterricht. Nachsitzen. Mein Katholizismus war beendet.
Thomas Gross schrieb kürzlich in der „Zeit“ über das 1980 gegründete Kölner Mag „Spex“, das sich einer ähnlichen Mission verschrieb, und Ende 2006 inhaltlich neupositioniert wurde : „Das Ende der Bescheidwisser: Die Allgegenwart von Musik hat die Popkritik in eine Krise gestürzt. Im Streit um »Spex«, einst das wichtigste deutsche Musikmagazin, zeigt sich die Sehnsucht nach alten Verbindlichkeiten. Doch der Kritiker als Stilpapst hat ausgedient“. Und Dietmar Dath, ein ehemaliger Redakteur, in der FAZ hingegen von “ SPEX als Fels in der Schlammflut der Verzweiflung“
Klar, beides könnte auch für die „Musicbox“ gelten. Aus heutiger Sicht überholt. Nur: ich hatte nur mein Radio. Ein Radio. Einen Fels. Von Allgegenwart von Popmusik noch keine Spur. Der Schulband – eingerichtet für rhythmische Messbegleitung – selbst zum Proben „Rolling Stones“ verboten. Wegen anzüglicher Texte. Heroisierung ausserehelichen Geschlechtsverkehrs. Kein Web und keinen Shop. Auf der Suche nach neuen Autoritäten. Verzweifelt.
Die „Box“ hatte Autorität. Uneingeschränkt im Osten von Österreich. Mangels Alternativen ausländischer deutschsprachiger Programme. Final bewiesen zehn Jahre später, 1992. Als in der ersten Ö3-Reform, eingeleitet als panische Reaktion des österreichischen Rundfunks auf den Erfolg der Antenne Steiermark als erstes Kommerzradio, sie in den Spätabend und ins Fegefeuer reformiert wurde – mit absehbarem Quotenverlust, hagelte es Proteste. Als diese erfolglos blieben, war SIE die Startfanfare für die „Wiener Piratenradios„. Dann machen wir halt selber. Wir haben euer Latein gelernt. Sich nix zu scheissen auch. Danke „Musicbox“. Danke.
Wer Musik hört, will Musik auch besitzen. Macht unabhängig. Wenn ich heute einen guten Track im Radio höre, schickt mir das Trackservice des Senders eine SMS mit Titel und Artist. Oder ich tippe mir eine Notiz ins Mobiltelefon. Und wenn ich Zeit habe, höre ich mir mir mehr vom Produzenten zum Beispiel per Last.FM an, checke den Website, den MySpace-Space, surfe die Links, sammle, suche aus. Dann werfe ich eine Filesharing-Software an, lasse Mp3´s runterladen, schmeisse die Hälfte – Scheiss – nach dreimal hören wieder weg. Was übrig bleibt landet in meiner Soundbibliothek am Computer, manches wenige auf dem MP3-Player. Und wenn, dann, ja dann etwas so gut ist, besteht, zehn mal gehört, zwanzigmal gehört, noch immer gut, dann kaufe ich mir manchmal eine CD. Wertiger. Und wenn das Cover supergeil, dann will ich Vinyl. Am wertigsten. Weil Grafikdesign im Grossformat. Und pilgere dazu vielleicht ins „Rave Up“, ein Plattengeschäft in Wien. Plausche, schnüffle, stöbere, aber ich weiss eigentlich schon vorher was ich will. Sie kennen das sicher alles. So funktioniert Musik jetzt. Nicht alles davon ganz legal – wer parkt schon nie am Gehsteig? – nur jeder und jede macht es ungefähr so. Heute.
1982. Wir begannen mit Bootlegs. Record-Play – Abzugsfinger auf Pause, entstanden Meisterwerke partieller Wahrnehmung. Verdichtungen unserer subjektiven Neigungsprofile, gebannt auf C60 oder C90. Wir verfluchten klemmende Tasten, in unsere Tracks hineinquatschende Wichtigmacher hinter den Mikros und Tape-Ende GENAU beim wichtigsten Song. Wir experimentierten mit Kopien und Remixes dieser Sammlungen. Zwei oder drei Rekorder Grill an Grill aneinandergeschoben, einer zum Aufnehmen, die anderen zum Abgeben. Wir gaben bald auf.
„Der Österreichische Schallplattenklub der Jugend hat die Zielsetzung, gute Musik unter jungen Leuten populär zu machen“, schrieb Ernst Prowaznik, seines Zeichen Geschäftsführer, über das pädagogische Konzept desselben, und weiter „Es genügt nicht, die Anschaffung und Auswahl von Platten ausschließlich dem Tagesgeschmack der Jugendlichen selbst zu überlassen. Wer ein wenig versucht hat, junge Menschen zum richtigen Hören guter Schallplatten zu erziehen, ist erstaunt über die Erfolge, die dabei zu erzielen sind.“
Verweilen wir ein wenig bei diesem Konstrukt der 1960er, gegründet in Erweiterung der Buchklubidee, repräsentiert und vertrieben durch Musikpädagogen an den österreichischen Schulen. Und Mitte der 1980er dann mausetot. Erstaunlich, mit welchem erzieherischen Impetus der schmale Begriff „Selbst“ – Selbstfindung, Emanzipation, Selbstbefriedung – als „Gefahr“ dargestellt und mit „Richtig“ etwas entgegengestellt werden sollte. Nur was ist „Richtig“? Wer „Spricht“?
Nicht, dass die Zeichen verkannt worden wären – „Erst wenn die Anschaffung von Schallplatten keine besonderen finanziellen Probleme mehr aufwirft, kann die musikpädagogische Funktion der Schallplatte wirksam in Erscheinung treten. Erst dann kann in vielen jungen Menschen der Wunsch erwachen, das nunmehr bereits Bekannte auch in irgendeiner Form selbst klanglich zu realisieren“, geht es weiter im Konzept – nur es herrschte: Hilflosigkeit. Hilflosigkeit in Anerkennung, dass der frühere rechtskonservative Wertekanon der Republik, der Jugendkultur generell als „schädlich“ für staatliches, bürgerliches Gefüge sah, in den 1970ern zerborsten war. Ahnungslos in der Annahme, nur weil Jugend Götter sucht, sie Gott ausgerechnet finden wird beim: Musikpädagogen.
Unser Musiklehrer war ein ein jüngerer – unter vierzig – und etwas dicklicher Pater mit Pausbacken. Die rot anliefen, wenn ihm etwas nicht passte. Ihm passte oft nicht. Bei ihm bestellten wir unsere ersten LPs. Aus dem bunten Katalog des „Schallplattenklubs“. Der uns alles mögliche mit salbungsvollen Worten empfahl. Ich wusste, was ich wollte. Was sich nur manchmal mit dem empfohlenen Programm deckte. Und umständliche Hoffnungsbestellungen nach Bandname/Scheibentitel/Label mit längeren Wartezeiten verursachte. Traf das Paket ein – hoffentlich ist mein Teil diesmal dabei! – pflegte er ihm unbekanntes Material vorzuhören. Was häufig der Fall war. Und bei Ausgabe mit geistreichen Kommentaren, mit klassischen Bezügen zu verzieren. Zu versuchen. Es war lächerlich. Es war demütigend. Es brachte Rügen ein. Es endete in unauflösbaren Auseinandersetzungen. „Die Monstershow im Petersdom“ auf „Morak“ – das 1980 erschienene Debütalbum des heute weniger respektierten Ex-Staatssekretärs – ist antiklerikal. Sicher. Und „Kleine Schwester“ Inzest. Sicher. Deswegen hatte ich bestellt. „Burgschauspieler“. Franz Morak war Burgschauspieler. Die Rettung. Provokationen waren einfach. Er hatte es nicht einfach.
Wir organisierten unsere eigenen Sammelbestellungen. Beim „Meki-Versand“. Dessen kleine, auf Buntpapier kopierte Heftchen man sich zuschicken lassen konnte. Tausender Sound in winzigster Schreibschrift. Ohne Empfehlung. Ohne Werte. Ohne Verhör.
Der Plattenspieler stand im Aufenthaltsraum. Neben dem Tischtennis-Tisch. Nahe der Erzieher-Wohnung. Natürlich. Kontrolle ist alles. Ein Plattenspieler für alle. Eines der Geräte, die mit tonnenschwerem Tonarm Rillen fräsen. Statt unsere Heiligtümer zu streicheln. Es war uns egal.
Ich hatte schlechte Karten. „Fehlfarben“ gegen „Iron Maiden“? Zum Vergessen. „Blümchenblau“ gegen „Ambros“? Zum Abstinken. „Chuzpe“ gegen „Electric Light Orchestra“? Reden wir nicht davon.
Nur: Wer Musik hat, will anderen davon mitteilen. Egal, ob die wollen oder nicht.
Ich weiss nicht mehr, wessen Idee es war. Vielleicht lag es einfach in der Luft. Wir wollten einfach mehr. So wie unser Radio. Es ist da, und es hat Macht. Über die, die keine Wahl haben. Ohnmächtig sind. Es hat Autorität. Du willst Macht. Und Autorität . Und Luftkanäle, die der Autorität vorbehalten sind, die sie für sich geschaffen hat, dir nehmen. Kapern.
Wir hatten Glöckner. Aufstehen, Pause, Andacht, dafür gab es eine Glocke im Gang. Glocke, Seil. Glöckner zu sein, war hart. Und nicht besonders begehrt. Früher aufstehn, immer auf die Uhr sehn. Wenn ein Glöckner versehentlich spät läutete, dauerte etwas lang. Mit Sicherheit etwas Unangenehmes. Ein Glöckner war nicht beliebt. Dafür Unterrichtsstunden, lästige Vokabelprüfungen unentschuldigt verlassen können. Freiheit durch Pflicht. Glöckner wurde nur jemand, der zuverlässig war. Aus Sicht des Hauses. Ich nicht. Als Pfahl.
Die Glocke wurde abgeschafft. Die Sprechanlage eingeführt. Zum Läuten. Zum alles. Plötzlich waren überall Lautsprecher. Am Gang, am Klo, im Zimmer. Überall. Wir hatten Bedürfnis. Zur Mitteilung. Wir explodierten vor Mitteilungsbedürfnis. Und hatten Platten. Zum Auflegen. Unsere. Ich glaube, es war die Idee des letzten Glöckners. Und Schlagzeugers. Der Schulband, die nicht mit „Stones“ proben durfte. Und „Genrosso“ – eine katholische, italienische Ausdruckspoptanzband – satt hatte. Die er covern sollte.
Er machte „Radio“. Seines. Und einige – wie ich – machten mit. Unseres. Meines. Es wurde geduldet. Als Versuch.
Der Deal war einfach. Sie bekamen mit, was wir hörten. Wollten. Dachten. Wir sassen mit unserem Radiorekorder, Schul-Plattenspieler, Boxen vor dem Mikrophon der Sprechanlage. In der Direktion. Morgens. Moderierten. Sagten an. Sie standen vor uns, und hörten sich an. Duldeten.
Es war lehrreich. Selbstzensur. Wir hatten Codes. „Rauchen heute dort und dort“ hiess irgendwie. Anderes Verbotenes anderswie. Das merkten sie bald. Unsere Musik lief. Meine Musik lief. Überall. Es schlief ein. Sie spielten auf Zeit. Zu mühsam. Für uns. Alles frühmorgens. Bis Unterricht.
Aber für kurze Zeit ging wieder ein Fenster auf. Eines, wo nicht nur Wind hereinweht. Sondern wir unseren Wind bliesen. Das habe ich mir gemerkt. Wenn du etwas willst, nimm es dir. Und lass dich nicht aufhalten. Auch wenn du scheiterst. Wir scheiterten. Vorerst.
Die 1980er waren ein Scheissjahrzehnt. Furchtbare Mode. Es läuft mir kalt über den Rücken, wenn – wie jetzt gerade – Legwarmers und Fönfrisuren Urstände feiern. Ok, Revivals haben Ironiefaktor. Für mich war es bitterer Ernst.
Innenpolitisches Niemandsland. Ein spürbar nachlassender Reformwille der Sozialismus – wie sich die Sozialdemokratie zu der Zeit noch nannte. Die sich an der Macht zerschliss, an Arroganz gewann. Und den Stillstand einleitete, der die 1990er prägte. Wenn man von den Wirkungen des österreichischen Betritts zur Europäischen Union absieht. In meiner Schulzeit bin ich von alldem sowieso kaum erreicht worden.
In den Köpfen „Cold War“ – als letzte davon geprägte Generation – verschliefen wir den sich abzeichnende Fall der Blöcke. Vielleicht war es zu undenkbar. Und waren überrascht, als das Undenkbare eintrat.
Wer Blöcke im Kopf, und Blöcke vor sich, hat Lust zu schlagen. Zerschlagen. Vielleicht erklärt sich auch dadurch der radikale, libertäre Geist meiner Generation. Anpasser sind wir nicht. Wir profitierten von den Freiheiten, die in den 1970ern erkämpft wurden. Auch wenn ich selbst noch genug Mief der 1960er atmen durfte.
Mit Wirkung zu tun, waren wir in unserem Jahrzehnt zu jung. Wir probten. Und taten in den 1990ern. Eine kultur- und gesellschaftspolitisch fruchtbarere Dekade. (Von Alf Altendorf, 2007)






