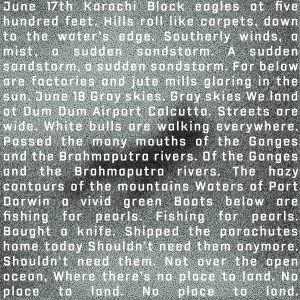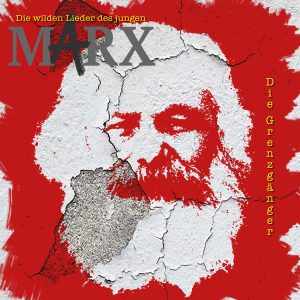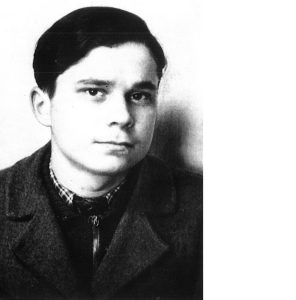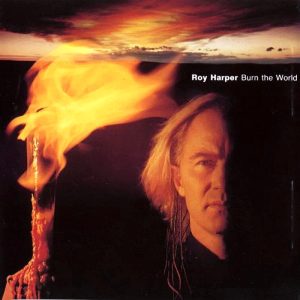> Sendung: Artarium vom Sonntag, 10. November – Seltsam, im Nebel zu stochern. Oder unter dem Teppich nachzuschauen, was da schon so lang drunter gekehrt wird. Oder doch nicht? Die Generation der Nachkriegskinder ist mit erheblichen Leerstellen im Familiengedächtnis aufgewachsen. Mit Auslassungen, Umdeutungen und Tabus in der Erinnerung. Thomas Andreas Beck allerdings macht sich auf die Suche nach genau diesen unterbewussten Strömungen, die unsere Welt nach wie vor prägen, sowohl in der gesamten Gesellschaft als auch in der Persönlichkeit jedes einzelnen. Und dabei geht er dorthin, wo es wirklich weh tut, nämlich in sich selbst. Auf seinem Album “Ernst” (das wir heute vorstellen) verschmilzt er dieses Innen mit dem Außen zu einer ausgewogenen Wahrnehmung des Weltwahnsinns, der in und um uns wütet.
 Vor einem Monat präsentierte er sein aktuelles Buch “Der Keller ist dem Österreicher sein Aussichtsturm” in der matchBox in Schallmoos und dabei wurde ich von zwei Songs aus besagtem Ernst in eine mir ebenso unbekannte wie wohlvertraute Welt versetzt. “Das ist Ambivalenz! Das ist große Kunst!”, jubelte ich in mir drin und beschloss gleichauf, diese Bewusstseinserweiterung, für die man nicht einmal Drogen nehmen muss, auf dem kreativen Hörweg mit euch zu teilen. Denn wie bereits John Peel von der BBC feststellte: “Radio is and always will be a more powerful medium than television because it allows the imagination of the listener to flourish.” Es waren die Titel “Strones” (ein Lied über den absichtsvoll in die Versenkung verschwundenen Geburtsort von Hitlers Vater am Truppenübungsplatz Allentsteig) sowie “Deponie” (eine Zeitreise in die eigene Kindheit – was auf mehreren Ebenen zugleich funktioniert, nämlich, weil es die Kindheit von vielen von uns berührt).
Vor einem Monat präsentierte er sein aktuelles Buch “Der Keller ist dem Österreicher sein Aussichtsturm” in der matchBox in Schallmoos und dabei wurde ich von zwei Songs aus besagtem Ernst in eine mir ebenso unbekannte wie wohlvertraute Welt versetzt. “Das ist Ambivalenz! Das ist große Kunst!”, jubelte ich in mir drin und beschloss gleichauf, diese Bewusstseinserweiterung, für die man nicht einmal Drogen nehmen muss, auf dem kreativen Hörweg mit euch zu teilen. Denn wie bereits John Peel von der BBC feststellte: “Radio is and always will be a more powerful medium than television because it allows the imagination of the listener to flourish.” Es waren die Titel “Strones” (ein Lied über den absichtsvoll in die Versenkung verschwundenen Geburtsort von Hitlers Vater am Truppenübungsplatz Allentsteig) sowie “Deponie” (eine Zeitreise in die eigene Kindheit – was auf mehreren Ebenen zugleich funktioniert, nämlich, weil es die Kindheit von vielen von uns berührt).
Dann ist mir noch etwas völlig Unerwartetes passiert (und es sind ja oft die Dinge, die “einfach passieren”, die einem wie von selbst neue Sichtweisen eröffnen). Ich nenne es jetzt einmal “Kreatives Verhören” (im Sinne von “da hab ich mich wohl verhört”). Aus dem Nebenraum hörte ich eine Nummer vom Album “Ernst” mit einem einzigen veränderten Buchstaben, wodurch aus der eigentlichen Aussage jeder Textzeile eine Frage entstand und ich das gesamte Lied als eine “offene Frage” auffasste, deren Antwort sich erst durch seinen Titel ergab. Hier die von mir “verhörte” Version:
Was frisst die Seele auf
Was macht dich hin
Was macht dich deppad
Viel deppader als sie
Was macht dich ängstlich
Was macht dich lieblos
Was macht dich neidig
Was macht dich blind
Was macht dich einsam
Was macht dich stumpf
Was macht dich starr
Was macht dich traurig
Was macht dich bitter
Was macht dich giftig
Was macht dich süchtig
Was macht dich krank
Was macht dich dunkel
Was macht dich brutal
Was macht dich gefährlich
Was macht dich mächtig
Was frisst die Seele auf
Was macht dich hin
Was macht dich tot
Viel toter als sie
Thomas Oberender empfiehlt: “Hören sie genau hin …”
PS. Um jedweder Velwechsrung von vorn herein (und auch im nachhinaus) vorzubeugen: Das oben abgedruckte ist die auf meinem “kreativen Verhören” basierende Version. Der originale Songtext ist allhier nachzulesen.