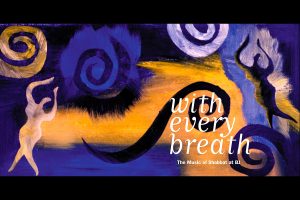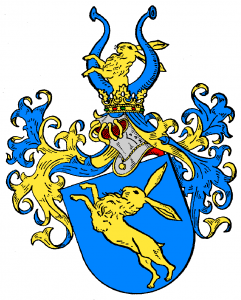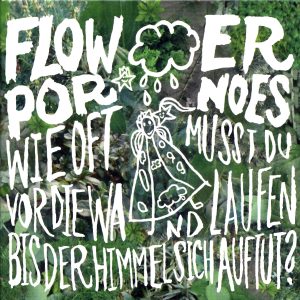> Sendung: Artarium vom Sonntag, 28. August “Wissen sie, wie wir reden zuhause? Wissen sie nicht! Weil – mit ihnen reden wir nicht so. Weil sie sind unsere Arbeitgeber. Aber wollen sie wissen, wie wir untereinander reden? Wollen sie den serbischen Originalton einmal wirklich übersetzt hören? Wir ficken euch, Oida! Sehen sie, wie unangenehm ihnen das ist?” Zu diesem sprachlichen Höhepunkt postjugoslawischer Völkerverständigung steigert sich Malarina in ihrem Soloprogramm “Serben sterben langsam” empor, mit dem sie letzten Sommer auch schon in Salzburg zu Gast war. Ficken kann ja – je nach Kontext – vielerlei bedeuten. Und seit der Frage, ob man das auf einer CD überhaupt sagen darf, ist so viel Freiheit den Bach runter geflossen, dass wir endlich einen Sendungstitel damit garnieren können. Freies Radio, Oida!
 Mit ihrer konsequent angewandten Satire trägt Malarina mehr zum Verständnis untereinander bei als irgendein Politkasperltheater, das den Begriff “Integration” vor sich her vergewaltigt. Gerade in Zeiten weltweiter Kulturzerstörung durch die “Diktatur des Konsumismus” (Pasolini) kann das Herumreiten auf überspitzten Klischees dabei helfen, sich selbst und die anderen noch zu erkennen. “Die Wirklichkeit bis zur Kenntlichkeit entstellen.” So wird der Zweck von Satire beschrieben. Und wenn man sich im Erkennen selbst (wieder) spürt, dann ist der Weg zum Einfühlen in andere auch nicht mehr so weit. Wohlgemerkt, hierbei geht es um aus sich selbst heraus entwickelte Gefühle und nicht um antrainierte gefühlsähnliche Reflexe, die durch die jeweils passenden Schlüsselreize abgerufen werden, genauso unwillkürlich wie ein plötzlicher Rülpser. Letztere zu entlarven als hinterfotzige Mechanismen der Massenbeeinflussung, meist durch rechtsextrem konservative Soziopathen und Glaubensgemeinschaften, das gelingt ihr elegant – etwa mit ihrer “serbisch-österreichischen Geschichtsstunde”.
Mit ihrer konsequent angewandten Satire trägt Malarina mehr zum Verständnis untereinander bei als irgendein Politkasperltheater, das den Begriff “Integration” vor sich her vergewaltigt. Gerade in Zeiten weltweiter Kulturzerstörung durch die “Diktatur des Konsumismus” (Pasolini) kann das Herumreiten auf überspitzten Klischees dabei helfen, sich selbst und die anderen noch zu erkennen. “Die Wirklichkeit bis zur Kenntlichkeit entstellen.” So wird der Zweck von Satire beschrieben. Und wenn man sich im Erkennen selbst (wieder) spürt, dann ist der Weg zum Einfühlen in andere auch nicht mehr so weit. Wohlgemerkt, hierbei geht es um aus sich selbst heraus entwickelte Gefühle und nicht um antrainierte gefühlsähnliche Reflexe, die durch die jeweils passenden Schlüsselreize abgerufen werden, genauso unwillkürlich wie ein plötzlicher Rülpser. Letztere zu entlarven als hinterfotzige Mechanismen der Massenbeeinflussung, meist durch rechtsextrem konservative Soziopathen und Glaubensgemeinschaften, das gelingt ihr elegant – etwa mit ihrer “serbisch-österreichischen Geschichtsstunde”.
Es ist nämlich unendlich kostbar, sich in jemand anderen “einzufühlen”, sich mitsamt seiner eigenen Welt einer anderen Welt anzuverwandeln, ein Geschenk der Liebe zu sein inmitten von feiger Berechnung. Sich über die Fesseln der Konvention zu erheben und der fremdelnden Welt ein Gemeinsames darzuleben, indem man deren Klischees dem erlösenden Lachen anheim stellt. Und um die Völkerverständigung dieser erfrischenden Frau unserem Wesen nach weiter zu betreiben, fügen wir das Antikriegslied eines Kroaten sowie eine Hymne auf die Albanien-Nostalgie hinzu …
Oder wie Sebastian Kurz gesagt hätte: “Ich habe die Balkontüre geschlossen.” Oida!